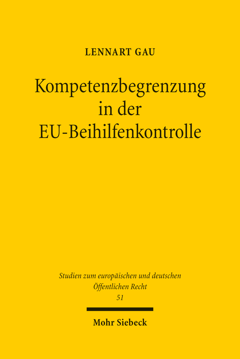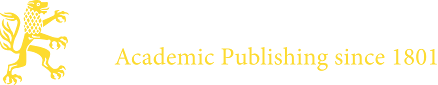State aid cases have often raised fears of an EU competence creep. However, a close look at the evolution of the Court of Justice of the European Union case law reveals a different picture. In its interpretation of State aid law, the Court has become increasingly sensitive to national competences.
State aid cases have often raised fears of an EU competence creep. However, a close look at the evolution of the Court of Justice of the European Union case law reveals a different picture. In its interpretation of State aid law, the Court has become increasingly sensitive to national competences.
Table of contents:
A. EinleitungI. Fragestellung
II. Überblick zum Forschungsstand
III. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands
IV. Aufbau der Untersuchung
V. Methodisches Vorgehen
B. Die unionale KompetenzverteilungI. Über die Schwierigkeit, in der EU über Kompetenzen zu sprechen
II. Zum Kompetenzverständnis dieser Arbeit
III. Die Kompetenzverteilung: Funktionsweise und Abgrenzung
IV. Fazit: Die Herausforderungen der Kompetenzverteilung
C. Das Beihilfenrecht im unionalen KompetenzsystemI. Überblick zum Beihilfenrecht
II. Die kompetenzrechtlichen Wirkungen des Beihilfenrechts
III. Typisierung der Kompetenzkonflikte durch die Beihilfenkontrolle
IV. Fazit: Das Beihilfenrecht im Spannungsfeld zwischen Binnenmarkt- und Kompetenzschutz
D. Die allgemeine Entwicklung der Kompetenzverteilung und der BeihilfenkontrolleI. Entwicklung der Kompetenzverteilung und -begrenzung in der EU
II. Entwicklung der Bedeutung des Beihilfenrechts
III. Fazit: Das Zusammenwirken der Entwicklungen
E. Die Entwicklung der Beihilfenrechtsprechung in kompetenzrechtlicher HinsichtI. Fokus der Untersuchung
II. Entwicklung der Beihilfenrechtsprechung im Steuerrecht
III. Entwicklung der Beihilfenrechtsprechung im Sicherheitssektor
IV. Der sachgebietsübergreifende Trend zu mehr Kompetenzerwägungen
V. Zusammenführung der Rechtsprechungsentwicklungen
VI. Bewertung der Beihilfenrechtsprechung
F. Vorschlag zur Änderung der BeihilfenkontrolleI. Bisher bestehende Ansätze
II. Eigener Vorschlag: Berücksichtigung von Kompetenzgrenzen in der Beihilfenprüfung
III. Fazit: Die Grenzen der Änderung der Beihilfenkontrolle
G. Schlussfolgerungen: Die Stabilität in der Dynamik der EUI. Schlussfolgerungen für das Verständnis des unionalen Kompetenzsystems
II. Schlussfolgerungen für die Funktionsweise der Beihilfenkontrolle
III. Schlussfolgerungen für die Integrationsdynamik der EU