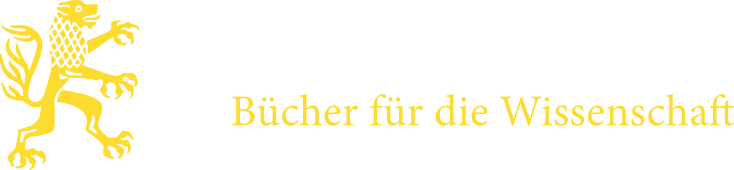Wer nach Wundern fragt, stellt die Machtfrage und fragt nach dem Wirken Gottes in der Welt. Wunder interpretieren und schaffen Wirklichkeit. Michael Rydryck zeigt, dass dies auch für die Strafwunder im Lukasevangelium und der Apostelgeschichte gilt, die ein zentraler Bestandteil der theologischen Deutung von Wirklichkeit sind.
Die Wunderforschung berührt den Kern christlicher Theologie im Allgemeinen und neutestamentlicher Forschung im Besonderen, denn mit der Wunderfrage stellen sich neben der Machtfrage zentrale Fragen nach den Konzepten von Wirklichkeit und nach der Weltwirksamkeit Gottes innerhalb und außerhalb der Texte des Neuen Testaments. Michael Rydryck entwirft eine konsequent wirklichkeitshermeneutische Wunderdefinition und fokussiert auf dieser Basis Strafwunder in den Texten des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte als eine bislang in der Forschung kaum berücksichtigte Form von Wundern. Dabei zeigt sich, dass Strafwunder keineswegs Ausdruck eines rückständigen Gottesbildes oder einer antiken Wundersucht sind, sondern unverzichtbarer Bestandteil einer genuin theologischen Deutung von Wirklichkeit in den Texten des lukanischen Doppelwerkes.
Inhaltsübersicht:
1. Einleitung
1.1. Zwei Szenen und ein Satz: Strafwunder als wirklichkeitshermeneutisches und theologisches Problem
1.2. Methodische Prämissen und Wegmarken
2. Wege der Wunderforschung: Entwürfe und Aporien
2.1. Verzweigung der Wege
2.2. Paradigmen
2.3. Formgeschichtliche Standards
Exkurs 1: Systematisch-theologische Schlaglichter
2.4. Religionsgeschichtliche Perspektiven auf formgeschichtlicher Basis
2.5. Kritik am Weg der Formgeschichte
Exkurs 2: Die gegenwärtige Wunderforschung im Spiegel von Sammelbänden
2.6. Neue Wege der Wunderhermeneutik
2.7. Fokussierung: Wunderhermeneutik in der Forschung zum lukanischen Doppelwerk
3. Wunder und Wunderbegriff: Grenzen und (Spiel-)Räume
3.1. Wirklichkeitshermeneutische Desiderate der Wunderforschung
3.2. Liminale, Wirklichkeit erschließende Aspekte der Wunderterminologie im Neuen Testament und im lukanischen Doppelwerk
3.3. Hermeneutische Grundlagen einer Wunderdefinition
3.4. Ein wirklichkeitshermeneutischer Wunderbegriff
3.5. Strafwunder als Wunder an den Widersachern
Exkurs 3: Dämonenaustreibungen als Wunder an den Widersachern?
4. Die Wunder an den Widersachern im lukanischen Doppelwerk
4.1. Ein ironischer Auftakt: Das Verstummen des Zacharias im Kontext von Lk 1
4.2. Kein Wunder an den Widersachern: Transgressionen in Lk 9,51-56
4.3. Tun, Ergehen und Deuten: Gerichtswunder in Lk 13,1-9
4.4. Lk 23,44-48: Warnzeichen für die θεομάχοι
4.5. Ein tragischer Auftakt: Der Straftod des Judas in Apg 1,15-20
4.6. Ein tragisches Diptychon: Der Tod von Ananias und Saphira im Kontext von Apg 2-5
Exkurs 4: Ein Negativbefund: Simon Magus und Simon Petrus in Apg 8,4-24
4.7. Eine ironische Wandlung: Saulus in Apg 9,1-22
4.8. Ironie und Tragik: Herodes Agrippa I. in Apg 12,1-24
Exkurs 5: Befreiungswunder als Wunder an den Widersachern?
4.9. Eine ironische Szene: Die Erblindung des Barjesus Elymas in Apg 13,4-12
4.10. Die doppelte Ironie der dunklen Seite: Das Wunder an den Widersachern der Dämonen in Apg 19,11-20
4.11. Ein ironischer Ausklang: Paulus in Apg 28,1-6
5. Die Wunder an den Widersachern im lukanischen Doppelwerk: Kontexte und Forschungsdesiderate
5.1. Zusammenfassung der exegetischen Erträge
5.2. Narratologische und theologische Kontextualisierungen der Wunder an den Widersachern im Makrotext des lukanischen Doppelwerks
5.3. Die theologische Bedeutung der Wunder an den Widersachern und Desiderate der Forschung
6. Literatur- und Medienverzeichnis