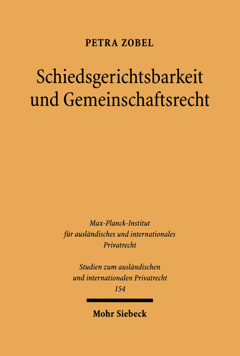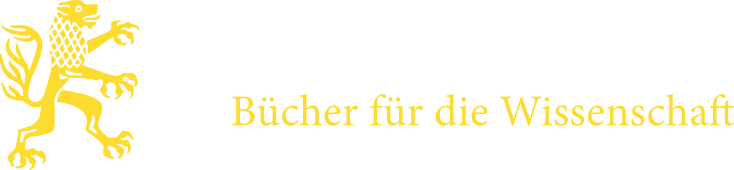Die Rechtspraxis zeigt, dass die Schiedsgerichtsbarkeit und das Gemeinschaftsrecht keine isolierten Phänomene darstellen. Ihr gegenseitiges Verhältnis wirft vielmehr komplizierte Rechtsfragen auf. Petra Zobel untersucht in differenzierter Form die Frage der Integration der Schiedsgerichtsbarkeit in das Gemeinschaftsrecht oder aber ihrer Exklusion aus dem Gemeinschaftsrecht.
Die Institution der Schiedsgerichtsbarkeit hat sich im internationalen Handelsverkehr als ein 'Erfolgsmodell' erwiesen. Die Europäische Gemeinschaft verhält sich bei der Regulierung der Schiedsgerichtsbarkeit zurückhaltend. Die Rechtspraxis zeigt allerdings, dass die Schiedsgerichtsbarkeit und das Gemeinschaftsrecht keine isolierten Phänomene darstellen. Petra Zobel geht daher der Frage nach, inwieweit die Schiedsgerichtsbarkeit in das System der Gemeinschaftsrechtsordnung integriert ist. Sie untersucht das Verständnis des Anwendungsbereiches des Europäischen Schuldvertragsübereinkommens (EVÜ) und kommt zu dem Ergebnis, dass das EVÜ die Vertragsstaaten nicht verpflichtet, die für Schiedsgerichte geltenden Kollisionsregeln entsprechend dem EVÜ auszugestalten: eine sinnvolle Exklusion. Ferner zeigt die Autorin auf Grundlage der Nordsee- und Eco Swiss-Entscheidung eine Disharmonie von Integration und Exklusion auf. Zum einen werden die Schiedsgerichte im Rahmen der Anwendungspflicht zwingender Vorschriften des Gemeinschaftsrechts in das europäisches Rechtssystem integriert, andererseits im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens wieder exkludiert. Zur Auflösung dieser Disharmonie fordert die Autorin, den Schiedsgerichten die Vorlageberechtigung nach Art. 234 EGV einzuräumen.
Diese Arbeit wurde im Mai 2006 mit dem DIS-Förderpreis der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) ausgezeichnet.
Inhaltsübersicht:
Einleitung
A. Einführung: Begriff der privaten Schiedsgerichtsbarkeit
B. Die Schiedsgerichtsbarkeit - Rechtssicherheit und Rechtseinheitlichkeit
C. Anerkennung der Schiedsgerichtsbarkeit
D. Problemaufriss - Integration und Exklusion
E. Gang der Untersuchung
1. Kapitel
Europäisches Kollisionsrecht
A. Das EG-Schuldvertragsübereinkommen und die internationale Schiedsgerichtsbarkeit
I. Problemstellung
II. Art. 3ff. EVÜ und Art. 28 UNCITRAL-Modellgesetz - der Spagat des deutschen Gesetzgebers
III. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit: Bindung des Gesetzgebers an das EG-Schuldvertragsübereinkommen
1. Derzeitiger Meinungsstand
2. Kritische Würdigung
3. Eigener Ansatz - Auslegung des EG-Schuldvertragsübereinkommens
4. Ergebnis und Ausblick
B. Ergebnis: Exklusion der Schiedsgerichtsbarkeit
2. Kapitel
Einbindung der Schiedsgerichtsbarkeit in die europäische Gemeinschaftsrechtsordnung: Die Nordsee- und die Eco Swiss/Benetton-Entscheidung
A. Bindung der Schiedsgerichte an das Europäisches Gemeinschaftsrecht
I. Geltung, Vorrang und Unmittelbarkeit des Europäischen Gemeinschaftsrechts
II. Konsequenz für die staatlichen Gerichte
III. Konsequenzen für die Schiedsgerichte
IV. Ergebnis
B. Vorlageberechtigung der Schiedsgerichte nach Art. 234 EGV
I. »Gericht eines Mitgliedstaats« - die Ansicht des EuGH
II. Verweigerung der Vorlageberechtigung: Kritik
III. Die Vorlageberechtigung der Schiedsgerichte: eigene Ansicht
IV. Ausgestaltung der Vorlagemöglichkeit nach Art. 234 EGV
V. Lokalisierung: »Gericht eines Mitgliedstaats«
VI. Die Reform der europäischen Gerichtsbarkeit und die Schiedsgerichtsbarkeit
C. Ergebnis: Integration und Exklusion der Schiedsgerichtsbarkeit
Anhang I: Internationale Rechtsquellen
Anhang II: Nationale Rechtsquellen