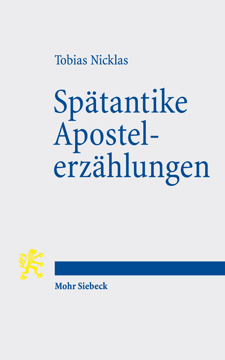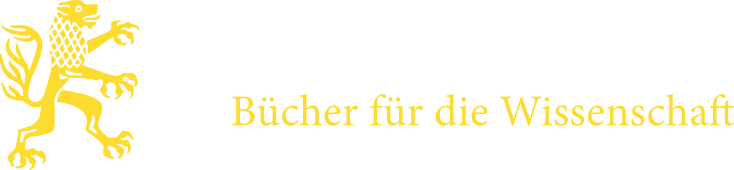Theologisch und historisch wertlos? Tobias Nicklas zeigt, dass die bisher wenig beachteten spätantiken Apostelerzählungen vielmehr als fortgeführte Jesus-Christus-Erzählungen, Angebote zur Identitätsbildung, politische Statements und wichtige Zeugnisse christlicher Symbolgeschichte zu verstehen sind.
Die Forschung an spätantiken Apostelerzählungen leidet bis heute unter einer Vielzahl von Vorurteilen: Die Texte seien historisch wertlos, literarisch schlecht und theologisch problematisch. Tobias Nicklas zeigt mit vielen Beispielen, dass dies nicht der Fall ist. Seine Untersuchung bleibt nicht bei den bekannten Apostelakten der Frühzeit, also den Paulus-, Petrus-, Andreas-, Johannes- und Thomasakten stehen, sondern überschreitet immer wieder die Grenzen zur Spätantike, ja zum frühen Mittelalter und damit zur Hagiographie. In insgesamt vier Durchgängen zeigt er, wie die Apostelerzählungen die Evangelien fortschreiben, indem sie Christus zu ihrem eigentlichen Protagonisten machen. Überaus komplex stellt sich auch das Verhältnis zwischen den in den Texten angebotenen »christlichen« Identitäten und den alten Kulten, aber auch griechisch-römischen Bildungstraditionen dar. Der Autor zeigt zudem, auf welch verschiedenen Ebenen antike Apostelerzählungen als politische Statements verstanden werden können. Zwar sind sie kaum als anti-imperiale Kampfschriften zu verstehen, aber sie erwarten von ihrer Adressatenschaft die totale Hingabe zu Christus und dem Gott der Christen. Apostelerzählungen und, mit ihnen verbunden, Apostelgräber und Reliquien spielen zudem eine wichtige Rolle in innerkirchlichen Auseinandersetzungen um den Rang von Teilkirchen. Gleichzeitig lässt sich an ihnen zeigen, auf welche Weise Charaktere wie Petrus, Paulus oder Thekla zu Symbolfiguren wurden, die bis heute christliches Denken prägen.