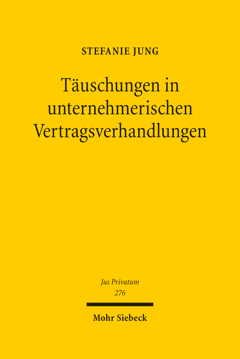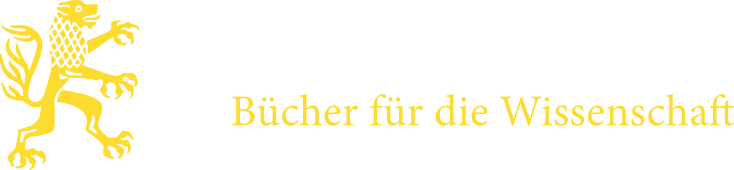In unternehmerischen Verhandlungen wird vor allem über Aspekte wie bessere Alterantivangebote, Interessen oder die Verfügbarkeit gelogen. Stefanie Jung untersucht aus rechtshistorischer, rechtsdogmatischer, rechtsvergleichender, rechtsökonomischer und empirischer Sicht, ob das deutsche Recht Verhandlern im unternehmerischen Kontext einen Spielraum für bestimmte Irreführungen gewährt bzw. gewähren sollte.
In unternehmerischen Verhandlungen sind Täuschungen durchaus verbreitet und zielen darauf ab, das Verhandlungsergebnis zu beeinflussen. Gelogen wird dabei vor allem über Aspekte wie bessere Alternativangebote, Deadlines, die Verfügbarkeit eines Produkts oder unternehmensinterne Vorgaben. Die Verhandlungsliteratur stuft viele dieser Lügen außerhalb des Vertragsgegenstands und des Preises als akzeptierte Geschäftspraxis ein. Ein erster Blick auf § 123 Abs. 1, 1. Alt. BGB (Anfechtung wegen arglistiger Täuschung) legt hingegen nahe, dass vorsätzliche, kausal gewordene Täuschungen ausnahmslos als unrechtmäßig anzusehen sind. Eine für das Werk durchgeführte Studie zeigt allerdings, dass z.B. deutsche Richter für einige dieser Lügen keine rechtlichen Konsequenzen fordern. Stefanie Jung untersucht daher, ob das deutsche Recht Verhandlern im unternehmerischen Kontext einen Spielraum für bestimmte Irreführungen gewährt bzw. gewähren sollte. Auf Basis rechtshistorischer, rechtsdogmatischer, rechtsvergleichender, rechtsökonomischer und empirischer Argumente arbeitet sie eine differenzierte Lösung nach einzelnen Täuschungsgegenständen heraus.
Inhaltsübersicht:
1. Teil Einleitung und GrundlagenA. Einleitung
B. Begrifflichkeiten
C. Die Siegener Studie zu Lügen in Vertragsverhandlungen
2. Teil Der Status quo der unternehmerischen Praxis und des RechtsA. Die Praxis von Täuschungen in unternehmerischen Vertragsverhandlungen
B. Rechtlicher Status quo in Deutschland
3. Teil Die Täuschungsproblematik aus rechtshistorischer und rechtsvergleichender Perspektive und die Konsequenzen für das deutsche RechtA. Rechtshistorische Betrachtung
B. Rechtsvergleichende Perspektive
C. Die Betrachtung zentraler Regelungselemente aus rechtsvergleichender und rechtshistorischer Sicht
D. Weitere denkbare Regelungselemente
E. Ergebnisse des 3. Teils
4. Teil Wertungsmäßige Betrachtung, insbesondere für Deutschland
A. Potenzielle Wertungsfaktoren
B. Moralische Bewertung von Täuschungen in Vertragsverhandlungen
C. Das Rechtsgefühl bezüglich Täuschungen in Vertragsverhandlungen
D. Das Judiz zu Täuschungen in Vertragsverhandlungen
E. Zwischenergebnis zu Moralvorstellungen, Rechtsgefühl und Judiz
F. Die Bedeutung des Moralverständnisses, des Rechtsgefühls und des Judizes für das Recht sowie deren Verhältnis zueinander
G. Ökonomische Analyse von Täuschungen in Vertragsverhandlungen
H. Rechtliche Umfeldwertungen
I. Die Grenzziehung zwischen »listigen« und arglistigen Bluffs anhand von Täuschungsgegenständen - Zusammenfassung und Gesamtbewertung der erzielten Ergebnisse
5. Teil Konstruktive Lösung für DeutschlandA. Lösung de lege lata
B. Lösung de lege ferenda
6. Teil Ergebnisse
A. Das Ergebnis in a nutshell
B. Die Beantwortung der Forschungsfrage
C. Kritische Reflektion des erzielten Ergebnisses
D. Detaillierte Darstellung der erzielten Ergebnisse