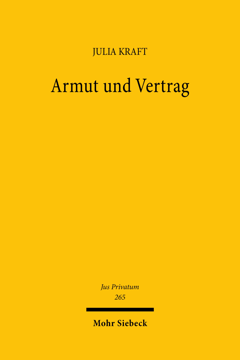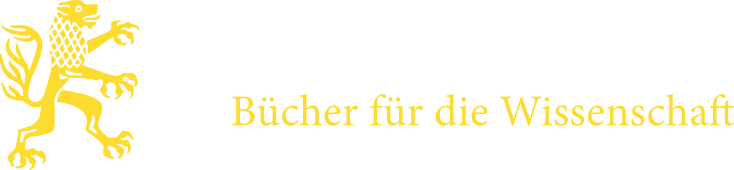Welchen Beitrag leistet das Vertragsrecht zur Bekämpfung von Armut? Julia Kraft konfrontiert die in der Rechtsökonomik geführte Umverteilungsdebatte mit einem auf Freiheit aufbauenden ökonomischen Ansatz und zeigt, dass Armutsbekämpfung nicht ohne die Unterstützung des Vertragsrechts gelingen kann.
»Eine Reihe gesellschaftlicher Institutionen [...], Parlamente [...], Gerichte [...] und die Gesellschaft insgesamt [...] werden genau dadurch zu Entwicklungsfaktoren, daß sie sich auf die Erweiterung und die Aufrechterhaltung der Freiheiten des einzelnen positiv auswirken«, schreibt der Ökonom und Philosoph Amartya Sen in seinem Werk Ökonomie für den Menschen. Was hat es mit dieser freiheitserweiternden und freiheitssichernden Aufgabe des Gesetzgebers und Richters auf sich, wenn es um die Bekämpfung von Armut in einer sozialstaatlich fundierten Wohlstandsgesellschaft wie der unsrigen geht? Welche Rolle kommt dabei dem Vertragsrecht zu? Und warum lässt sich die einfache Dichotomie zwischen dem Steuer- und Sozialrecht als »Umverteilungsabteilung« und dem Vertragsrecht als »Allokationsabteilung« nicht aufrechterhalten, wenn man sich auf die Idee einer freiheitsorientierten Umverteilung einlässt? Julia Kraft geht diesen Fragen nach und fördert mit Hilfe eines auf Freiheit aufbauenden ökonomischen Ansatzes den liberalen Wert eines sozialen Vertragsrechts zutage.
Inhaltsübersicht:
Einleitende VorbemerkungenA. Armut und Rechtswissenschaft
B. Methodischer Ansatz und Forschungsfragen
C. Warum eine Befähigungsperspektive auf das Vertragsrecht?
D. Untersuchungssubjekt und Untersuchungsgegenstand
E. Gang der Untersuchung
Erstes Kapitel: Grundlegung§ 1 Befähigungsansatz im Gefüge von Politik und Wissenschaft
§ 2 Ökonomischer Entstehungszusammenhang
§ 3 Grundgüter und Wohlergehen
§ 4 Befähigung und Wohlergehen
§ 5 Freiheitsorientiertes Armutsverständnis
§ 6 Zusammenfassung
Zweites Kapitel: Anwendung§ 7 Vertragsfreiheit als Fähigkeit?
§ 8 Recht im Befähigungsansatz
§ 9 Befähigungsdenken in Rechtsetzung und Rechtsanwendung
§ 10 Vertragsrecht als Entwicklungsfaktor
§ 11 Zusammenfassung
Drittes Kapitel: Legitimation§ 12 Legitimationsprogramm
§ 13 Freiheit als Mittel und Ziel
§ 14 Warum gleiche Grundfähigkeiten?
§ 15 Warum einer und nicht alle?
§ 16 Humanisierung des ökonomischen Vertragsdenkens
§ 17 Zusammenfassung
SchlussbetrachtungA. Freiheitsorientierte Rechtsbeschreibung
B. Freiheitsorientierte Rechtsgestaltung
C. Umverteilung von Freiheiten