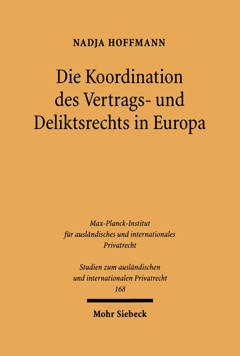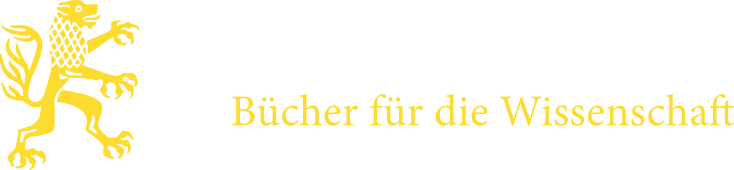Nadja Hoffmann erläutert die Methoden zur Koordination des Vertrags- und Deliktsrechts, sowie deren Koordination in grenzüberschreitenden Sachverhalten. Abschließend untersucht sie das Verhältnis des nationalen internationalen Deliktsrechts zum internationalen Einheitsrecht am Beispiel des UN-Kaufrechts. Insgesamt nimmt die Arbeit eine rechtsvergleichende, europäische Perspektive ein.
Derzeit wird eine EU-Verordnung zum internationalen Deliktsrechts und langfristig auch ein Europäisches Zivilgesetzbuch vorbereitet. Nadja Hoffmann befasst sich zunächst mit der Koordination des Vertrags- und Deliktsrechts in sechs europäischen Rechtsordnungen. Dort wird überall zwischen Vertrags- und Deliktsrecht differenziert und meist werden beide Gebiete auf einen Sachverhalt angewendet. Stets ist jedoch eine Feinabstimmung unter Berücksichtigung des Schutzes des Geschädigten und der vertraglichen Risikoallokation notwendig. Diese Interessenabwägung fällt in den Rechtsordnungen unterschiedlich aus.
Eine künftige EU-Verordnung zum internationalen Deliktsrecht muss mit dem bereits vereinheitlichten internationalen Vertragsrecht abgestimmt werden. Die Autorin plädiert dafür, die Rechtswahl für deliktsrechtliche Sachverhalte zuzulassen. Die akzessorische Anknüpfung deliktsrechtlicher Sachverhalte an das Vertragskollisionsrecht sollte europaweit eingführt oder alternativ im Anschluss an die Bestimmung des anwendbaren Rechts eine materiell-rechtliche Anpassung eines Vertragsrechts aus einem Land an das Deliktsrecht aus einem anderen Land durchgeführt werden. Abschließend untersucht die Autorin, wie das UN-Kaufrechts mit dem internationalen Deliktsrecht zu koordinieren ist.
Inhaltsübersicht:
Kapitel 1. Einleitung
A. Fragestellung und Herangehensweise
B. Auswahl der Rechtsordnungen
C. Ziele und Struktur der Arbeit
Kapitel 2. Sachrecht
A. Einführung
B. Grundlagen zur Beziehung zwischen Vertrags- und Deliktsrecht
C. Die Koordination des Vertrags- und des Deliktsrechts
D. Schlussfolgerungen
Kapitel 3. Koordination von Vertrags- und Deliktsrecht im Kollisionsrecht
A. Einleitung
B. Übersichten über das Kollisionsrecht
C. Möglichkeiten eines faktischen Gleichlaufs der Regelanknüpfungen
Kapitel 4. Koordination im IPR durch Parteiautonomie und Konkurrenzregel
A. Parteiautonomie
B. Konkurrenz zwischen Vertrags- und Deliktsrecht im Kollisionsrecht
Kapitel 5. Kollisionsrechtliche Alternativen zur Konkurrenz
A. Qualifikation
B. Anpassung
C. Das Prinzip der engsten Verbindung als Grundlage einer umfassenden Kollisionsnorm
D. Akzessorische Anknüpfung
E. Entwicklungsmöglichkeiten
Kapitel 6. Interaktionen des Vertragsstatuts in das Deliktsstatut
A. Freizeichnung vor Eintritt des schädigenden Ereignisses
B. Kritik und Stellungnahme
Kapitel 7. Culpa in contrahendo - Vorvertragliche Haftung als Beispiel für die Anknüpfung eines Rechtsinstituts sui generis
A. Rechtswahl für die vorvertragliche Phase
B. Objektive Anknüpfung
Kapitel 8. Gesamtwürdigung zum Kollisionsrecht
A. Gemeineuropäischer Status quo im Kollisionsrecht
B. Koordinationsvergleich
Kapitel 9. Koordination von UN-Kaufrecht und nationalem Deliktsrecht
A. Einleitung
B. Koordinationswege des UN-Kaufrechts
C. Lückenfüllung und externe Koordinationswege
D. Zusammenfassung
Kapitel 10. Schlussbetrachtungen
A. Koordinationsvergleich
B. Gesamtzusammenfassung