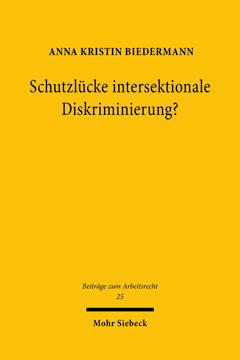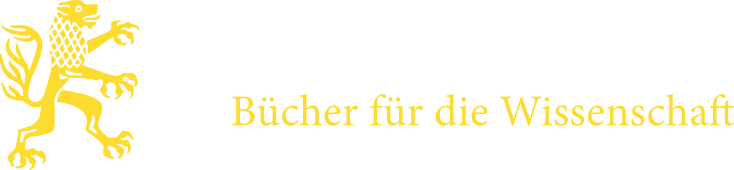Die intersektionale Diskriminierung erfasst als eigenständige Diskriminierungsform Benachteiligungen, die an der Schnittstelle verschiedener Diskriminierungsmerkmale stattfinden und im geltenden Antidiskriminierungsrecht nicht berücksichtigt werden. Anna Kristin Biedermann arbeitet heraus, wie diese Schutzlücke unter Rückgriff auf die europäische Grundrechtecharta geschlossen werden kann.
Das geltende Antidiskriminierungsrecht bildet tatsächliche Diskriminierungserfahrungen nur unzureichend ab. Die gesetzlich vorgesehene Anknüpfung an einzelne Diskriminierungsmerkmale stellt jene Benachteiligungen schutzlos, die durch eine untrennbare Verschränkung mehrerer Merkmale gekennzeichnet sind. Diese Diskriminierung an der »Schnittstelle« verschiedener Merkmale macht das Konzept der Intersektionalität sichtbar. Es legt die dem Recht zugrunde liegenden gesellschaftlichen Machtstrukturen offen. Anna Kristin Biedermann verdeutlicht die Notwendigkeit, die Schutzlücke der intersektionalen Diskriminierung zu schließen. Sie schlägt einen rechtsdogmatisch gangbaren Weg vor, wie die Schnittstelle als eigene Diskriminierungsform unter Rückgriff auf das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot im privaten Arbeitsverhältnis verankert werden kann.
Inhaltsübersicht:
Einführung
Teil 1: Intersektionale Diskriminierung de lege lata: Probleme in der Kontextualisierung§ 1 Bedeutung der Intersektionalität für das Antidiskriminierungsrecht
§ 2 Intersektionalität im Antidiskriminierungsrecht de lege lata
§ 3 Kategoriales System als Ursache der unsichtbaren Intersektionalität im Antidiskriminierungsrecht
§ 4 Zusammenfassung: konzeptionelle Unsichtbarkeit der intersektionalen Diskriminierung im geltenden Recht
Teil 2: Privatrechtsgestaltendes Potential von Art. 21 Abs. 1 GRCh für die intersektionale Diskriminierung§ 5 Schnittstelle als eigene Kategorie in Art. 21 Abs. 1 GRCh
§ 6 Allgemeine dogmatische Wirkungen der Unionsgrundrechte im nationalen privaten Arbeitsrecht
§ 7 Anwendungsbereich der Charta nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 Var. 2 GRCh
§ 8 Zusammenfassung: privatrechtsgestaltendes Potential von Art. 21 Abs. 1 GRCh
Teil 3: Dogmatische Herleitung der intersektionalen Diskriminierung aus Art. 21 Abs. 1 GRCh§ 9 Anwendbarkeit von Art. 21 Abs. 1 GRCh auf nationale Arbeitsverhältnisse in der Judikatur des EuGH
§ 10 Verpflichtung der mitgliedstaatlichen Judikative aus Art. 21 Abs. 1 GRCh
§ 11 Verpflichtung privater Arbeitgeberinnen aus Art. 21 Abs. 1 GRCh
§ 12 Zusammenfassung: dogmatische Herleitung der intersektionalen Diskriminierung aus Art. 21 Abs. 1 GRCh
Zusammenfassung und Schlussbetrachtung